Archiv | Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
es blieb in Zeiten der Corona-Pandemie zwar eher eine Randnotiz, doch wurde im Frühjahr 2020 in Mönchengladbach kurzzeitig mehr oder minder ernsthaft über die Wiedereinführung der Straßenbahn diskutiert - zumindest jedenfalls gab es einen politischen Vorstoß in dieser Richtung, der die Stadtverwaltung zu einer offiziellen Aussage veranlasste.
Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit die letzte Straßenbahn durch Mönchengladbachs Straßen fuhr. Die damalige Einstellung entsprach nicht nur dem Zeitgeist, sondern eine nachhaltige Sicherung hätte auch erhebliche Investitionen und die politische Bereitschaft einer finanziellen wie stadträumlichen Priorität für die Straßenbahn bedurft. Noch bis in die 1980er Jahre wurden in Deutschland Straßenbahnsysteme aufgegeben. Mitte der 1990er Jahren begann im westlichen Europa dann eine gewisse Renaissance der Tram - in Deutschland mit nur wenigen völlig neu (wieder)eingerichteten Systemen, vor allem aber in Frankreich mit einem fundamental neuen Verständnis der Rolle der Straßenbahn für Mobilität wie für Stadtgestaltung gleichermaßen.
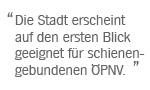 Die Überlegung, ob eine moderne Straßenbahn also nicht auch für Mönchengladbach ein sinnvolles Verkehrsmittel sein könnte, ist insoweit ausgesprochen sinnvoll. Qua Einwohnerzahl und Fläche erscheint die Stadt auf den ersten Blick durchaus geeignet für schienengebundenen Nahverkehr. Der genauere Blick auf Verkehrsachsen und -ströme zeigt zudem, dass sich auch für ein übergeordnetes ÖPNV-Netz einige Hauptachsen herausbilden lassen, die mit einer Straßenbahn zu bedienen wären. Zudem zeigt die Erfahrung, dass ein schienengebundenes Verkehrsmittel häufig höhere Fahrgastpotenziale aktivieren kann als ein Busverkehr, dieser Effekt ist in der Fachwelt unter dem Begriff „Schienenbonus“ bekannt.
Die Überlegung, ob eine moderne Straßenbahn also nicht auch für Mönchengladbach ein sinnvolles Verkehrsmittel sein könnte, ist insoweit ausgesprochen sinnvoll. Qua Einwohnerzahl und Fläche erscheint die Stadt auf den ersten Blick durchaus geeignet für schienengebundenen Nahverkehr. Der genauere Blick auf Verkehrsachsen und -ströme zeigt zudem, dass sich auch für ein übergeordnetes ÖPNV-Netz einige Hauptachsen herausbilden lassen, die mit einer Straßenbahn zu bedienen wären. Zudem zeigt die Erfahrung, dass ein schienengebundenes Verkehrsmittel häufig höhere Fahrgastpotenziale aktivieren kann als ein Busverkehr, dieser Effekt ist in der Fachwelt unter dem Begriff „Schienenbonus“ bekannt.
Doch aus Sicht von Stadt als Finanzier und Verkehrsunternehmen als Betreiber sollten einige weitere Aspekte berücksichtigt werden. Da für die Verkehre abseits der Hauptachsen weiterhin Busse benötigt werden, würde eine Straßenbahn ein zweites ÖPNV-Verkehrssystem darstellen. Zwar könnten alle Overheadfunktionen bis hin zur Disposition durch eine gemeinsame Leitstelle gemeinsam mit dem Busverkehr genutzt werden, aber Bau und Betrieb der Infrastruktur, Wartung und Betrieb der Fahrzeuge bis hin zur Personalschulung erfordern komplett neue Kompetenzen und Infrastrukturen. Diese aufzubauen lohnt nur, wenn das damit betriebene Netz auch eine ausreichende Größe annimmt und nicht auf eine einzige Linie beschränkt bleibt - die Fixkostendegression spielt hier aus wirtschaftlicher Sicht eine enorme Rolle. Das gilt auch für den Betrieb: Der kostenaufwändigere Betrieb einer Straßenbahn ist vor allem dann gerechtfertigt, wenn die Fahrgastnachfrage so groß ist, dass in der Kombination aus eigener Infrastruktur und größeren Fahrzeugen mit einem einzigen Fahrer eine größere Zahl an Fahrgästen befördert werden kann als mit einem Bus.
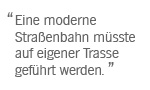 Dieses Kriterium erfüllen in Mönchengladbach derzeit nur wenige Achsen, da auf den allermeisten Relationen mit Gelenkbussen im 10-Minuten-Takt die gegenwärtige (und wohl auch die absehbare künftige) Nachfrage in angemessener Qualität bedient werden kann. Zudem ist das Busverkehrsnetz in Mönchengladbach durch zahlreiche Linienüberlagerungen geprägt, die in Hauptabschnitten einen dichteren Takt bei Verzweigung an den Endästen mit entsprechend vielen Direktverbindungen ermöglichen. Ein Straßenbahnsystem könnte realistischerweise nur die Hauptabschnitte abdecken, so dass für die Verteilung auf die verschiedenen Endäste mit Bussen gegenüber dem heutigen Zustand ein Umsteigezwang für die Fahrgäste entstehen würde. Neben diesen betrieblichen und Fahrgast-bezogenen Erwägungen ist freilich auch der stadtgestalterische Aspekt nicht zu vernachlässigen: Eine moderne Straßenbahn müsste auf weiten Teilen auf eigener Trasse geführt und dort ebenso wie auf etwaigen Mischverkehrsabschnitten im Straßenraum unstrittig gegenüber dem Individualverkehr priorisiert werden.
Dieses Kriterium erfüllen in Mönchengladbach derzeit nur wenige Achsen, da auf den allermeisten Relationen mit Gelenkbussen im 10-Minuten-Takt die gegenwärtige (und wohl auch die absehbare künftige) Nachfrage in angemessener Qualität bedient werden kann. Zudem ist das Busverkehrsnetz in Mönchengladbach durch zahlreiche Linienüberlagerungen geprägt, die in Hauptabschnitten einen dichteren Takt bei Verzweigung an den Endästen mit entsprechend vielen Direktverbindungen ermöglichen. Ein Straßenbahnsystem könnte realistischerweise nur die Hauptabschnitte abdecken, so dass für die Verteilung auf die verschiedenen Endäste mit Bussen gegenüber dem heutigen Zustand ein Umsteigezwang für die Fahrgäste entstehen würde. Neben diesen betrieblichen und Fahrgast-bezogenen Erwägungen ist freilich auch der stadtgestalterische Aspekt nicht zu vernachlässigen: Eine moderne Straßenbahn müsste auf weiten Teilen auf eigener Trasse geführt und dort ebenso wie auf etwaigen Mischverkehrsabschnitten im Straßenraum unstrittig gegenüber dem Individualverkehr priorisiert werden.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der mittelfristig zu erwartenden Nachfragezahlen im Mönchengladbacher ÖPNV scheint daher angeraten, den Fokus klar auf eine Stärkung des Busverkehrssystem zu legen. Punktuelle Verbesserungen der Infrastruktur durch Busspuren bzw. Busschleusen und Vorrangschaltungen verbunden mit einer klarer hierarchisierten Netzstruktur bieten hier noch zahlreiche Möglichkeiten, den bestehenden Busverkehr attraktiver zu machen. Das wäre mit kürzeren Realisierungszeiten, deutlich weniger finanziellem Aufwand und trotzdem spürbaren Nachfrageeffekten möglich - angesichts der Ausgangssituation in Mönchengladbach eine wesentlich realistischere und erfolgsversprechendere Überlegung, die allerdings nach den verpassten Chancen bei der zurückliegenden Neuaufstellung des Nahverkehrsplans selbst schon wie ein Blick in die ferne Zukunft anmutet.
Nicht zuletzt entlarvt denn auch der Auslöser der jüngsten Diskussion die wahre Motivation: Über das novellierte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stünden künftig erhebliche Fördermittel zur Verfügung, wenn eine Straßenbahn gebaut wird. Dem Ideengeber ging es also offenbar vor allem darum, Geld von Bund und Land einzuheimsen. Dass der Eigenanteil der Stadt an den Investitionen, vor allem aber die Kosten des Betriebs letztlich zu einer ungleich höheren Belastung des städtischen Haushalts führen würden als der heutige Busverkehr, scheint bei dieser Fördermittel-zentrierten Betrachtung außer Acht gelassen worden zu sein. Vor allem aber ist wohl die Suche nach dem besten ÖPNV-System für Mönchengladbachs Bedingungen mit dem höchsten verkehrlichen Nutzen nicht der Ausgangspunkt der Diskussion gewesen.
Reinbek, im Mai 2020
Manuel Bosch